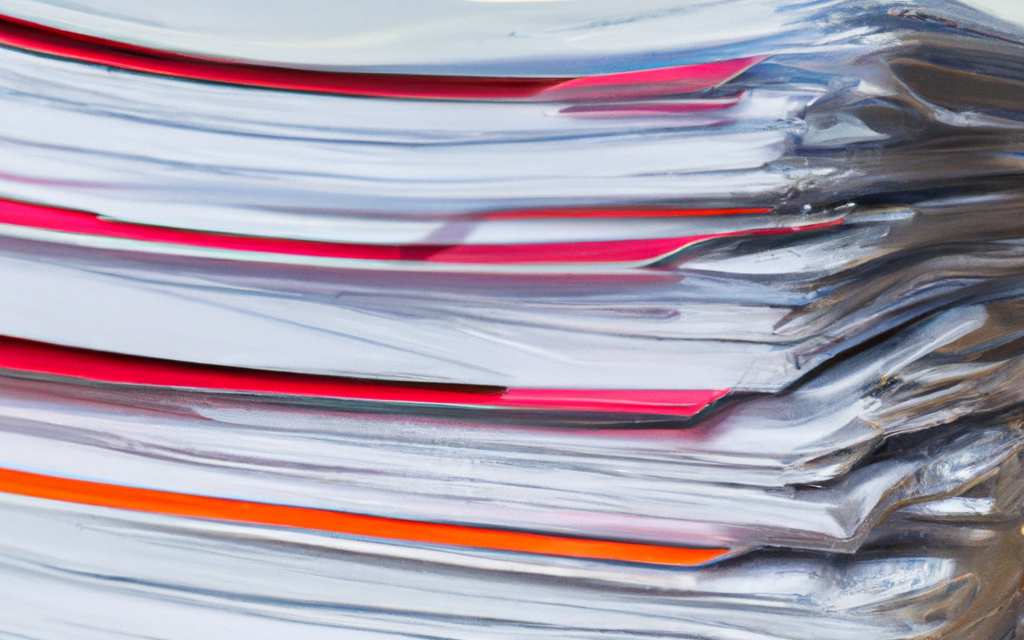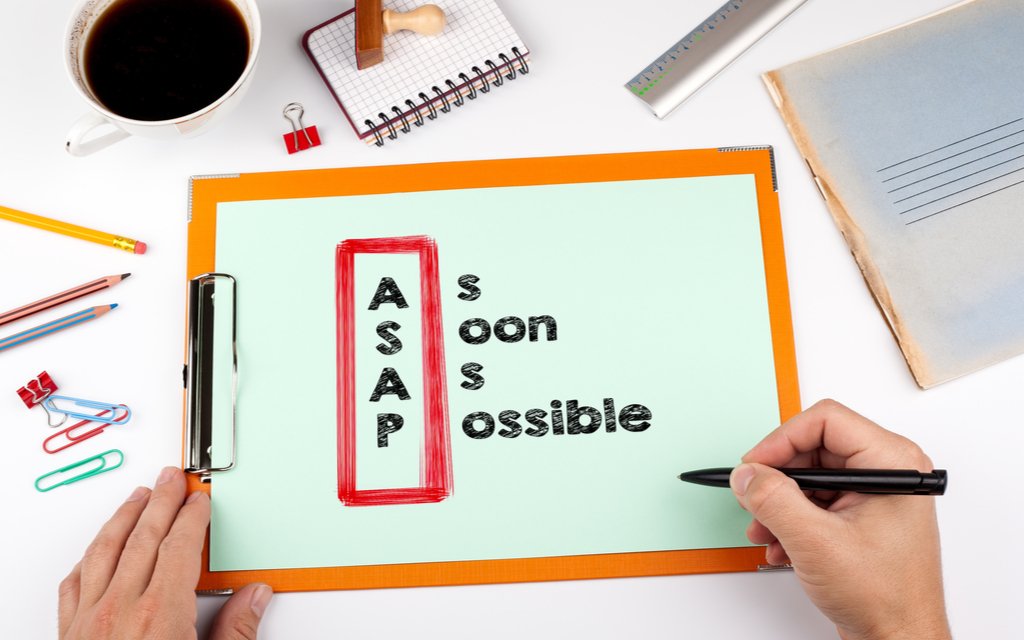Die Rolle der Assistenz hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Was früher vor allem durch Organisation, Verwaltung und klassische Bürotätigkeiten geprägt war, ist heute oft ein Knotenpunkt internationaler Kommunikation. Ob Telefonkonferenzen mit den USA, E-Mail-Korrespondenz mit Asien oder der Empfang internationaler Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner – das moderne Sekretariat agiert global.
Damit das funktioniert, braucht es mehr als Sprachkenntnisse oder gute Manieren: Interkulturelle Kompetenz wird zur Schlüsselqualifikation. Doch was genau steckt hinter diesem Begriff und wie lässt sich diese Fähigkeit im Alltag trainieren?
Was bedeutet interkulturelle Kompetenz?
Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, mit Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung erfolgreich zu kommunizieren und zu kooperieren. Dabei geht es nicht nur um das Wissen über kulturelle Unterschiede, sondern vor allem um die Fähigkeit, diese Unterschiede zu erkennen, zu respektieren und flexibel darauf zu reagieren.
Diese Kompetenz setzt sich im Wesentlichen aus drei Bestandteilen zusammen:
- Wissen über kulturelle Unterschiede: z. B. hinsichtlich Werten, Kommunikationsstilen, Zeitverständnis oder Umgangsformen.
- Fertigkeiten in interkulturellen Situationen: angemessen und lösungsorientiert handeln.
- Einstellungen: Empathie, Offenheit, Bereitschaft, eigene Sichtweisen zu hinterfragen.
Warum ist interkulturelle Kompetenz im Sekretariat so wichtig?
Im Assistenzbereich steht Kommunikation im Mittelpunkt. Wer internationale Gäste empfängt, virtuelle Meetings organisiert oder multinationale Teams koordiniert, repräsentiert das Unternehmen nach außen – oft als erste Kontaktperson. Umso wichtiger ist interkulturelle Kompetenz.
Gerade in diesem sensiblen Bereich ist es entscheidend, Missverständnisse zu vermeiden und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Ein falsch interpretierter Gruß, ein zu direkt formulierter Hinweis oder eine übersehene kulturelle Besonderheit können schnell Unmut erzeugen oder gar Geschäftsbeziehungen belasten.
Ein hoher Grad an interkultureller Kompetenz bedeutet daher nicht nur Professionalität, sondern auch Souveränität im internationalen Miteinander.
Kulturelle Vielfalt als Herausforderung – und Chance
- Kommunikationsstil: Während in Deutschland der direkte Ausdruck geschätzt wird, ist in vielen asiatischen Ländern eine indirektere, höflichere Kommunikation üblich. Kritik wird dort oft nur zwischen den Zeilen geäußert.
- Hierarchieverständnis: In Nordeuropa ist es üblich, Vorgesetzte mit Vornamen anzusprechen. In Ländern wie Südkorea, Indien oder Mexiko wird hingegen großer Wert auf den Titel und eine formelle Anrede gelegt.
- Zeitverständnis: In Deutschland oder der Schweiz gilt Pünktlichkeit als Zeichen von Zuverlässigkeit und Professionalität. In einigen anderen Kulturen – etwa in Teilen Südamerikas oder Afrikas – kann der Umgang mit Zeit flexibler sein. Zwischenmenschliche Beziehungen haben dort häufig Vorrang vor einem strikten Zeitplan.
Ein Beispiel aus dem Alltag
Eine deutsche Assistentin lädt zu einem virtuellen Team-Meeting ein. Die Teilnehmenden kommen aus Frankreich, Indien und den USA. Die Agenda ist präzise formuliert, die Uhrzeit in deutscher Zeitzone angegeben und die Assistentin erwartet ein schnelles Feedback.
Doch die Rückmeldungen bleiben aus. Erst einige Zeit später folgen Antworten – höflich, aber zögerlich. In Indien wird die E-Mail aufgrund des Diwali-Festes nicht sofort gelesen, für die amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist der angesetzte Termin unglücklich gewählt, da er während Thanksgiving liegt, und die französischen Kolleginnen und Kollegen empfinden den Tonfall als nicht angemessen.
Ergebnis: Interkulturelle Kompetenz ist im digitalen Zeitalter keine reine Option mehr – sie ist eine überfachliche Schlüsselkompetenz.
Interkulturell handeln – so gelingt der Büroalltag weltweit
Um kulturelle Missverständnisse zu vermeiden und eine professionelle Kommunikationsicherzustellen, helfen einige konkrete Verhaltensregeln.
- Informationen über kulturelle Gepflogenheiten sammeln: Schon einfache Online-Recherchen oder ein kurzes Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Ländern schaffen Sicherheit.
- Vermeidung von kulturellen Klischees: Nicht voreingenommen, aber gleichzeitig aufmerksam gegenüber kulturell geprägten Erwartungen sein.
- Anpassung der Kommunikation: Weniger direkte Formulierungen, eine „weiche“ Sprache sowie ein wertschätzender Ton können dabei helfen, kulturelle Barrieren zu überwinden.
- Offen und lernbereit bleiben: Fehler passieren – wichtig ist der konstruktive Umgang damit.
Sprachliche Sicherheit als Fundament: Business-Englisch im Sekretariat
Neben kulturellem Feingefühl ist eine sichere sprachliche Ausdrucksfähigkeit auf Englisch heute unverzichtbar. Denn Englisch ist in den meisten internationalen Unternehmen die Geschäftssprache – sei es im Schriftverkehr, im Kundenkontakt oder bei Meetings.
Doch viele Assistenzkräfte sind unsicher: Sind die Englischkenntnisse ausreichend? Welche Formulierungen sind höflich genug? Wie können Missverständnisse vermieden werden?
Hier helfen professionelle Sprachtrainings für Business-Englisch weiter. Speziell auf den Berufsalltag zugeschnitteneFirmensprachkursesind dabei besonders effektiv. Solche Kurse vermitteln unter anderem:
- Schriftliche Kommunikation: E-Mails, Terminvereinbarungen, Protokolle
- Telefontraining: Gesprächsführung, Höflichkeitsfloskeln, Rückfragen
- Meeting-Vokabular: Agenda-Management, Moderation, Einwandbehandlung
- Interkulturelle Sprache: Themen sensibel ansprechen
Oft wird das Angebot auch digital oder hybrid durchgeführt – ideal für den flexiblen Büroalltag.
Digital und global: Neue Anforderungen an die Kommunikation
- Emojis? In manchen Ländern zu informell, in anderen durchaus akzeptiert.
- Kameranutzung? In Deutschland Standard, in Japan oder Indonesien oft unangenehm.
- Stille im Meeting? In westlichen Kulturen ein Signal für Unsicherheit, in anderen ein Zeichen des Respekts.
Wer die digitalen Codes verschiedener Kulturen kennt, navigiert sicherer durch virtuelle Konferenzen und bringt Projekte schneller ans Ziel.
Weiterbildungsformate für interkulturelle Kompetenz
- Seminare und Präsenztrainings: Besonders effektiv, wenn sie praxisnah und interaktiv gestaltet sind.
- E-Learning-Angebote: Ideal für den flexiblen Wissensaufbau.
- Tandemprogramme: Gegenseitiger Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern stärkt nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern auch das kulturelle Verständnis.
- Teilnahme an internationalen Projekten oder Messen: Persönliche Erfahrungen sind oft die besten Lehrmeister.
Checkliste, um souverän im internationalen Kontext aufzutreten
- Kulturinformationen recherchieren
- Zeitzonen und Feiertage beachten
- Neutrale, höfliche Sprache wählen
- Auf Körpersprache und Tonfall achten
- Feedbackkultur verstehen – wann offen, wann indirekt
- Sprachliche Sicherheit durch Business-Englisch-Training ausbauen
- Missverständnisse ruhig und respektvoll ansprechen
Diese einfachen Maßnahmen haben große Wirkung: nicht nur für die Kommunikation, sondern auch für das Vertrauen auf internationaler Ebene.
Interkulturelle Kompetenz – die Zukunftsressource im Sekretariat
Die moderne Assistenz ist weit mehr als eine verwaltende Position. Sie ist Kommunikationsprofi, Koordinatorin/Koordinator, Kulturbotschafterin/Kulturbotschafter sowie Vermittlerin/Vermittler – und damit ein unverzichtbares Bindeglied in internationalen Organisationen.
Wer interkulturelle Kompetenz mitbringt und gezielt ausbaut, profitiert in mehrfacher Hinsicht:
- Sicherheit im Umgang mit internationalen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern
- Erweiterung der eigenen Sichtweise – ein Gewinn, auch persönlich
- Steigende Karrierechancen – interkulturelle Fähigkeiten sind gefragter denn je
Die Zukunft ist global – und mit der richtigen Haltung, soliden Sprachkenntnissen und interkulturellem Gespür ist das Sekretariat bereit, diese Zukunft mitzugestalten.