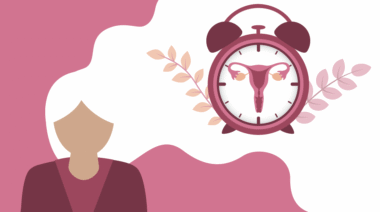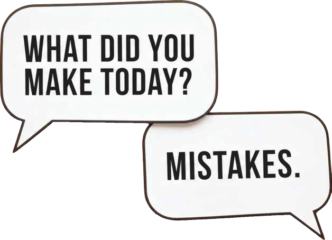Mehr Bauchgefühl? Wie wir gute Entscheidungen treffen
Kaffee oder Tee? Ferien am Meer oder in den Bergen? Im Job bleiben oder etwas Neues wagen? Entscheidungen prägen unser Leben, und oft stehen wir vor einer Vielzahl von Optionen; entsprechend schwierig gestalten sich für viele Menschen Entscheidungsprozesse, insbesondere in wichtigen Lebenssituationen.
Schnöde Pro-und-Contra-Listen führen hier meist nicht weiter. In seinem Buch „Gute Entscheidungen treffen – Wenn Sie wissen, was Sie wollen, können Sie tun, was Sie möchten“ gibt Autor Thomas Bergner neben konkreten Hinweisen, Tipps und Selbst-Checks ausführliche Einblicke in die Mechanismen des Entscheidens und macht dies an Fallbeispielen deutlich.
Was unsere Entscheidungen beeinflusst
Unsere Werte, frühe Prägungen, die Persönlichkeit, Muster, Überzeugungen, moralische Fragen und der momentane emotionale Zustand beeinflussen unsere Entscheidungen. Zudem ist das Belohnungssystem daran beteiligt, was wir gerade für das Beste halten. Je mehr wir diese Faktoren kennen, so die Erfahrung des Autors aus 25-jähriger Beratungstätigkeit, desto bessere Entscheidungen treffen wir.
Besonders wichtig sind unsere Ziele und unsere Motivation: „Motivation ist immer subjektiv“, schreibt Thomas Bergner. „Wir streben dann nach einem Ziel, wenn wir dafür motiviert sind. Ziele, die wir nicht mit irgendeiner Belohnung in Verbindung setzen können, interessieren uns nicht.“ Jede Entscheidung basiert auf einer oder mehrerer Motivationen. Diese können positiv (etwas anstreben) oder negativ (etwas vermeiden), extrinsisch (von außen kommend) oder intrinsisch (von innen entstehend) sein.
Hinter jeder Motivation verbirgt sich jedoch auch eine sogenannte Grundangst. Zum Beispiel ist unser Leistungsstreben verknüpft mit der Angst zu versagen. Der Experte empfiehlt, sich zu fragen, ob wir mit unserer Entscheidung unbedingt etwas vermeiden oder beruhigen wollen. Und ist es der beste Weg?
Wo ein Wille ist …
Zudem spielen mögliche Risiken bei der Entscheidungsfindung eine Rolle. Laut Bergner interessiert uns nicht nur das Ziel, sondern auch, wie wahrscheinlich es ist, dass wir es erreichen. Belohnungen prägen unser Verhalten. Sie sind ganz individuell (Zuneigung, Status, Geld, Anerkennung usw.) und bewirken einen Lernerfolg: Ich entscheide, handle, erhalte die Belohnung – oder eben auch nicht.
Dabei werden im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet, und die Hirnchemie verrechnet kontinuierlich, was wir erwarten und bekommen, was wir tun oder lassen. Auch unser Wille hat ein Wörtchen mitzureden: Wir brauchen ihn, um Widerstände zu überwinden und dabeizubleiben.
In seinem Buch gibt der Autor außerdem Einblicke, wie sich die Basis einer erwachsenen Entscheidung ab unserer frühen Kindheit entwickelt, welche Hirnregionen wie beteiligt sind, wie Persönlichkeitsmerkmale und Gefühlszustände Entscheidungen beeinflussen und welche Hindernisse das Unbewusste und mangelnde Erfahrung darstellen können.
Wer wie entscheidet
Entscheidungen variieren in ihrer Komplexität: Beim „Picking“ wählen wir einfach aus, z. B. am Buffet. „Choosing“ erfordert eine Vorentscheidung, etwa die Wahl eines Geschäfts vor dem Einkauf. „Opting“ umfasst große Lebensentscheidungen wie Beruf, Wohnort oder Partnerschaft. Entscheidungstypen beziehen sich auf menschliche Eigenschaften: „Einmal die Erfolgs-Zuversichtlichen, die realistische, mittelschwere Ziele verfolgen. Zum anderen die Misserfolgs-Ängstlichen, die zu hohe oder zu niedrige Ziele haben“, definiert Bergner.
Der Experte empfiehlt, sich bei bisher nicht erreichten Zielen zu fragen, ob wir das Ziel vielleicht zu hoch gesteckt haben. Denn wer sich zu schwierige Ziele setzt und diese nicht erreicht, kann langfristig noch ängstlicher und übervorsichtig werden.