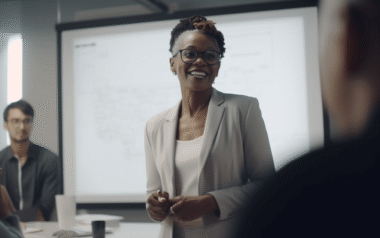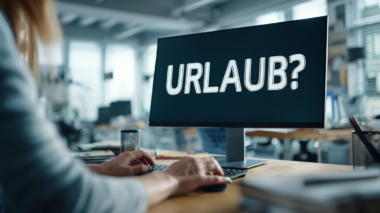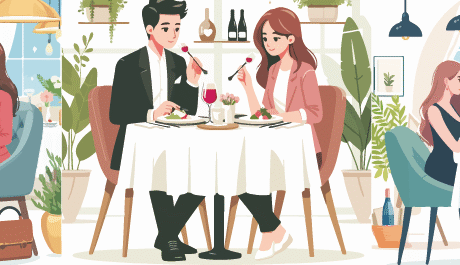
Was billige Dates mit der Konjunktur zu tun haben
Wenn alljährlich im Herbst Unternehmen und Politik im Lande an ihrer Budget- und Haushaltsplanung sitzen, werden sie von vielen mit Spannung erwartet: die Herbstgutachten, die eine Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung liefern und helfen, kommende Trends und Wendepunkte im Auf und Ab des Konjunkturzyklus vorauszuahnen.
Sie liefern damit Argumente für strategische Ausrichtung und Budget-Entscheidungen. Grob skizziert: Wachstum geht mit steigenden Einnahmen einher, was beispielsweise Spielräume für Investitionen schafft. Bei Abschwüngen stehen die Zeichen eher auf dem Drosseln der Kapazitäten, was oft die Personalplanung betrifft.
Ende September sagte die Gemeinschaftsdiagnose der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für dieses Jahr ein mageres Wachstum von 0,2 Prozent voraus. 2026 soll es dann bergauf gehen, so die Quintessenz des diesjährigen Herbstgutachtens.
Solche Prognosen basieren auf der Auswertung von Konjunkturindikatoren, d. h. statistischen Größen, die den aktuellen Zustand markieren oder die Entwicklungstendenz der Gesamtwirtschaft anzeigen. Mit Konjunktur ist die zyklische Entwicklung der Wirtschaft gemeint, also der Wechsel zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Perioden. So definiert Statista den Begriff für die Wellenbewegungen der gesamtwirtschaftliche Lage.
Spiegelbild des Wirtschaftsgeschehens
Diese Wellen spiegeln sich mit verschiedenen Anzeichen im Wirtschaftsleben wider: z. B. Beschäftigungsquote, Zinssätze, Kreditvergabe-Raten, Ausgaben für Forschung und Entwicklung, der Auftragslage für die Baubranche oder der Kauflust der Verbrauchenden. Manche nutzen originelle Konjunkturindikatoren wie etwa den Cheap-Date-Index.
Klassische Indikatoren werden von staatlichen Institutionen, Wirtschafts– und Marktforschungsunternehmen meist in kurzen Abständen aus vielen Datenquellen erhoben und lassen so Entwicklungen erkennen. „Konjunkturindikatoren wirken zunächst wie abstrakte Zahlenkolonnen – doch sie sind die Messinstrumente der Ökonomie“, erklärt StudySmarter. „Sie zeigen, wie sich eine Volkswirtschaft entwickelt, ob Aufschwung, Boom, Abschwung oder gar Krise vorherrscht, und helfen dabei, uns im Nebel unterschiedlichster Nachrichten zurechtzufinden.“
Früh-, Spät- und Präsenzindikatoren
Frühindikatoren deuten die künftige Lage voraus, wohin die wirtschaftliche Zukunft wahrscheinlich steuert. Auftragseingänge in der Industrie, Geschäftsklima-Indizes wie z. B. der ifo-Geschäftsklimaindex, Konsumklimaumfrage oder auch Lagerbestände gehören StudySmarter zufolge dazu: „Gehen beispielsweise die Auftragseingänge dauerhaft zurück, ist das ein Signal für eine bevorstehende Abschwungphase.“ Solche „Leading Indicators“ reagieren empfindlich auf Veränderungen und erlaubten deshalb eine Prognose über den kommenden Konjunkturverlauf.
Präsenzindikatoren wiederum bilden die aktuelle Situation ab. Dazu zählt einer der zentralen Anzeigewerte einer Volkswirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), aber auch Zahlen des produzierenden Gewerbes und Einzelhandelsumsätze. „Sie helfen besser zu verstehen, wie stark die Wirtschaft tatsächlich wächst oder schrumpft“, erläutert es StudySmarter. „Quasi das ,Echtheitszertifikat‘ für einen Konjunkturtrend.“
Spätindikatoren, wie zum Beispiel Preissteigerungen oder die Zahl der Insolvenzen, vollziehen die konjunkturelle Entwicklung mit Verzögerung nach. Sie laufen der Entwicklung hinterher. Warum man sie sich trotzdem nicht sparen sollte? Sie liefern gute Hinweise, um die Ausprägung von Veränderungen zu deuten. Die Beschäftigungsquote z. B. steigt oder fällt erst mit Zeitverzug, weil sich Arbeitsverträge hierzulande nicht mal eben kündigen und gute Arbeitskräfte nicht so schnell einstellen lassen. Da der Kündigungsschutz nicht überall gleich ist, zeigen sich hier international Unterschiede.
Gesellschaftliche, politische und globale Sondereffekte
Je nach Fokus und Zweck lässt sich das Wirtschaftsgeschehen mit unzählig vielen verschiedenen Kennzahlen vermessen. Diese können auch branchenspezifisch sein, wie z. B. Umsätze oder Einkäuferindizes, handverlesen für das eigene Geschäftsmodell oder sogar für persönliche Zwecke.
Wer etwa ein Haus kaufen will, achtet auf andere Parameter als ein Hausverkäufer. Im Aufschwung steigt meist die Nachfrage nach Immobilien, die Preise ebenso, Bauaktivitäten nehmen optimistisch zu, oft bei noch niedrigen Zinssätzen. In der Boomphase stabilisiert sich die Nachfrage, die Preise sind vielen langsam zu hoch. In einer Rezession läuft die Kurve mit höheren Zinsen und mehr Unsicherheiten umgekehrt, was auch die Investitionsbereitschaft bremst.
Auf die geeignete Kombination und den Kontext kommt es an, zumal oft auch Sondereffekte, die das lehrbuchhafte Bild von Konjunkturzyklen stören. Das können Ereignisse wie das querliegende Containerschiff im Suezkanal 2021 sein, das die wichtige internationale Wasserstraße massiv für Lieferketten blockierte, die Corona-Pandemie, Natur-Katastrophen oder politische Ereignisse wie etwa Kriege oder auch als eine unvorhersehbar empfundene Zollpolitik.