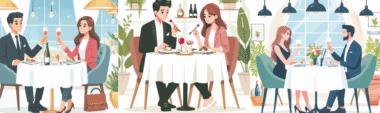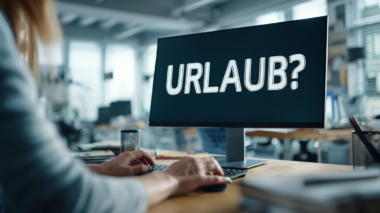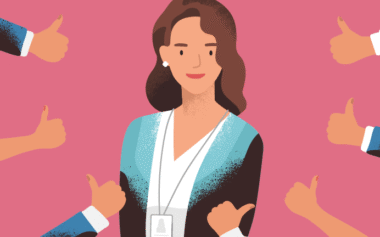Krisenmanagement: Wie wir lernen, schlimmste Ausnahmesituationen zu bewältigen
Sophie Schlömann fand nach einer eigenen beruflichen Krise – mitten in der COVID-19-Pandemie – zu ihrer heutigen Aufgabe. Ursprünglich aus dem Personalbereich kommend, erkannte sie während ihrer damaligen Coachingausbildung, wie stark ihr Bedürfnis war, wieder direkt mit Menschen zu arbeiten – jenseits von Excel-Tabellen und Projektstrukturen.
Deshalb entschied sie sich, etwas zu verändern. Seit mittlerweile fünf Jahren arbeitet sie als selbstständige Coach mit Menschen, die in existenziellen Umbruchsituationen stecken. Ihre Coachees stehen thematisch an sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten: von diffuser, aber nagender beruflicher Unzufriedenheit über Neuorientierung nach einer Trauerzeit, Krankheitsphase oder Burnout bis hin zu Erfahrungen wie Schwangerschaftsverlust oder Trennung.
Gemeinsam mit ihnen entwickelt sie Lösungswege, denn während oder nach einer Krise funktionieren vorherige Bewältigungsstrategien oft nicht mehr. Es braucht neue innere Räume. Ein geschützter äußerer Raum mit einem verständnisvollen Gegenüber kann dabei helfen, sich wieder zu sortieren.
„Die Menschen, die zu mir kommen, wissen: Jetzt ist etwas anders. Aber sie fragen sich: Wie entwickle ich etwas Neues? Was muss ich verändern?“, erzählt Sophie Schlömann, die wertvolle Erfahrungen als Trauerbegleiterin in ihre Coachingprozesse einbringen kann.
Was ist eine Krise?
Eine Krise unterscheidet sich deutlich von einer stressigen Phase, vor allem in Intensität, Dauer und subjektivem Erleben. Während Stress auch oft mit äußeren Faktoren wie Termindruck oder Konflikten zusammenhängt, ist eine Krise tiefgreifend, emotional hoch belastend und häufig körperlich spürbar. Stresssymptome klingen bestenfalls wieder ab, eine Krise ist dauerhafter, wobei die Zeitspanne individuell ist und sich über Monate oder länger erstrecken kann.
Eine Krise entsteht aus einem Schicksalsschlag oder einer massiven Veränderung, zum Beispiel einem Todesfall, einer schweren Krankheit, einer Trennung, einer Kündigung oder dem Eintritt in eine neue Lebensphase wie die Verrentung. Sie bringt das gewohnte Leben durcheinander und uns selbst aus dem Gleichgewicht. Starke Gefühle der Angst können entstehen sowie Ohnmacht, Verzweiflung, und Einsamkeit, begleitet von körperlichen Symptomen wie Schlaflosigkeit oder Erschöpfung.
Der Eindruck des Kontrollverlusts ist deutlich stärker als in stressigen Alltagssituationen, ebenso wie das Erleben von Überforderung und Ausweglosigkeit. „Eine Krise wirkt sehr bedrohlich“, sagt Sophie Schlömann. „Oft guckt man zunächst sehr hilflos und ohnmächtig zu.“
Wie wir eine Krise erkennen und wo wir Hilfe finden
Krisen entstehen häufig aus Schicksalsschlägen, die uns unvermutet treffen und die wir nicht beeinflussen können. Das können auch Naturkatastrophen und gesellschaftliche Ereignisse sein. Signale für ein Krisenerleben können sehr langanhaltende, intensive Gefühle sein, die wir in dieser Form nicht kennen und der Eindruck, dass uns unser Leben entgleitet. Es helfe, sich bewusst zu fragen: Wie viel Kontrolle habe ich noch über das, was ich tue?, empfiehlt die Expertin für Veränderungsprozesse. „Wenn die Antwort auf der Skala nahe null liegt, ist das ein deutliches Zeichen, dass ich in einer Krise stecke.“
Die Menschen, die zu Sophie Schlömann ins Coaching kommen, sind bereits wieder in der Lage, in einen „Lösungsraum“ einzutreten. Es gebe jedoch Zustände, die es nicht zulassen, an Lösungen zu denken. Für diejenigen, bei denen durch eine Krise eine schwere psychische Erkrankung ausgelöst wird, ist psychotherapeutische Unterstützung notwendig. Welche Form der Hilfe Menschen während und nach einer Krise benötigen, ist höchst individuell und unterschiedlich – je nach Vorerfahrungen, Lebenssituation und Persönlichkeit. Sophie Schlömann empfiehlt, so früh wie möglich Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Denn wenn wir merken, dass wir allein nicht weiterkommen, ist auch das bereits ein aktiver Schritt aus der Krise.